Prosa
Nacht
Ein kleiner Ort irgendwo in Deutschland. Es ist kurz vor Mitternacht. Alles ist dunkel. Auch in dem Haus neben dem kleinen Kinderspielplatz brennt kein Licht mehr. Außer dem Mond, der dank des klaren Himmels ein wenig Licht spendet, stehen jeweils in einigen Metern Entfernung Straßenlaternen auf den Gehwegen. Die Straßenlaterne vor dem Haus neben dem Spielplatz flackert und geht aus. Der Wind trägt ein leises Lachen durch die Straße. Ein junges Paar verschwindet in einem Mehrfamilienhaus. Im ersten Stock gehen nacheinander in verschiedenen Räumen die Lichter an und werden wieder ausgeschaltet. Alles ist ruhig. Alles schläft.
Im Haus neben dem Kinderspielplatz brennt kein Licht mehr. Wirklich nicht? Doch. Durch einen Türspalt sieht man einen schwachen Lichtschein. Die Tür ist aus Eichenholz. Die Türklinke scheint silbern zu sein, allerdings lässt sich das nicht mit Sicherheit sagen. Das Zimmer hinter der Tür ist nicht groß, aber auch nicht zu klein. Die Wände sind in einem hellen Gelb gestrichen. An den Wänden hängen bunte Wandbehänge aus dem südlichen Afrika. Auf dem Nachttisch steht ein aus Holz geschnitzter Elefant. Bei dem Verursacher des Lichtscheines handelt es sich um die Nachttischlampe. Neben dem Nachttisch steht das Bett. Die Bettwäsche hebt sich von der übrigen Einrichtung ab, sie ist farblich intensiver. Auf dem Bett sitzt eine junge Frau. Den Kopf schief gelegt, starrt sie auf ein teilweise beschriebenes Blatt Papier. Nach einiger Zeit schließt sie kurz die Augen und beginnt dann zu schreiben.
Nach einigen Stunden legt sie den Stift auf den Nachttisch. Die beschriebenen Blätter legt sie umgedreht auf den Boden. Sie schaltet die Nachttischlampe aus und streckt sich. Im Schein des Vollmondes sieht man, dass sie lächelt.
Der Schatten
Kurz nachdem ich ihn das erste Mal gesehen hatte, starb meine Katze. Damals war ich fünf Jahre alt. Eines Tages lag meine Katze auf der Fensterbank und er stand neben ihr. Ich dachte mir nichts dabei. Er war für mich nichts Ungewöhnliches. Vielleicht ein Freund meiner Eltern. Im nächsten Moment war er dann auch schon verschwunden. Ab dem Zeitpunkt sah ich ihn täglich. Immer an der Seite eines Tieres, eines Menschen oder einer Pflanze. Manchmal sah ich auch mehrere. Trotzdem war ich irgendwie sicher, dass es immer ein und derselbe war. Er: das war der Schatten.
Ich wurde erwachsen und erzählte einigen Vertrauten von dem Schatten. Sie wussten, dass ich nicht verrückt bin, deswegen glaubten sie mir. Allerdings wussten sie auch nicht, was ich tun sollte. Da der Schatten mir nie etwas zuleide tat, versuchte ich ihn anzusprechen, als ich ihn eines Tages vor einem Baum antraf. Er schaute mich nur stumm an und schüttelte den Kopf. Ich hatte ihn gefragt, wer er sei. Abermals schüttelte er den Kopf. Ich hatte wissen wollen, ob er diesmal wegen mir hier sei. Zuletzt fragte ich ihn, ob ich mir Sorgen machen müsse. Er schüttelte den Kopf und verschwand.
Allmählich kam ich in die Jahre. Es fiel mir schwerer, die Treppen zu meiner Wohnung hinaufzusteigen. Ich war immer schneller außer Atem. Außerdem sah ich schlechter. Ich erkannte die Namen auf den Türschildern bald nicht mehr. Deshalb bekam ich eine Lesebrille.
Eines Morgens stand er neben meinem Bett. Er begleitete mich beim Anziehen, beim Duschen, beim Einkaufen, beim Kochen, beim Essen, beim Fernsehen. Bei allem, was ich tat. Schweigend. Tagelang.
Schließlich sprach er: „Du darfst jetzt fragen“. Also fragte ich und er antwortete. Als die Abenddämmerung einsetzte, sagte er: „Es wird Zeit zu gehen“.
Ich lächelte und nickte.
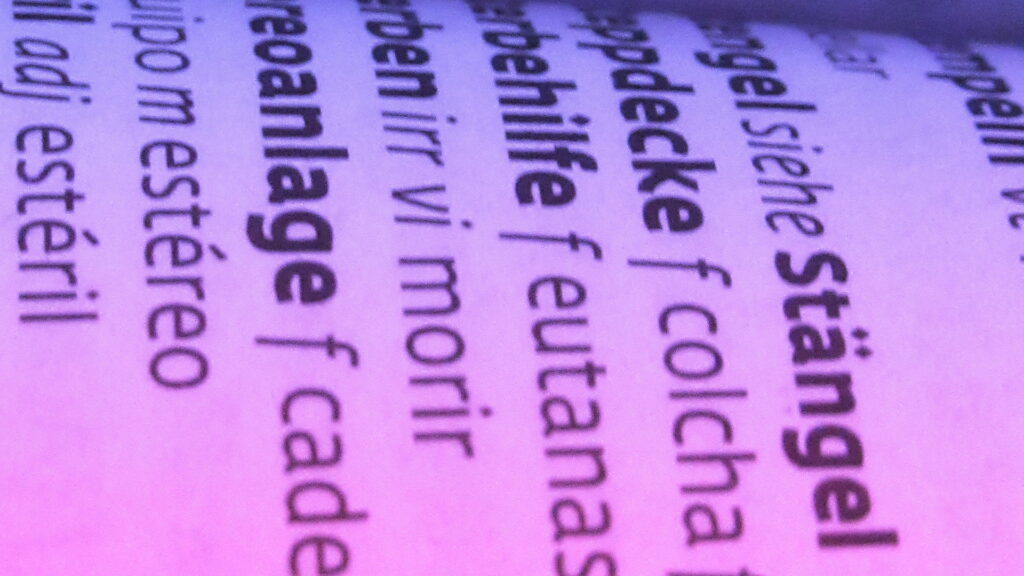
Der Wind
Sie war ratlos. Die anderen hatten sie gefragt, woher sie wusste, dass dort am Straßenrand eine junge Mutter stand, die mit zitternden Händen ein Kleinkind auf den Arm nahm. Sie konnte es schließlich unmöglich gesehen haben. Die anderen hatten Recht. Sie hatte die aufgelöste Mutter mit ihrem Kind wirklich nicht gesehen. Der Wind hatte es ihr erzählt.
Der Wind erzählte ihr unaufhörlich, was in der Welt geschah. Selbst wenn sie sich in einem Gebäude aufhielt, konnte sie das Flüstern des Windes hören. Der Wind war ihr Freund. Ihr bester und wahrscheinlich sogar ihr einziger Freund. Die anderen nannten sich zwar auch Freunde, aber sie hatte ihre Zweifel. Die Zweifel kamen immer dann, wenn die anderen versuchten, sie dazu zu bewegen, sich anzupassen. Das tat der Wind nie. Der Wind wollte nicht, dass sie sich anpasste.
Was sollte sie nun auf die Frage antworten, woher sie das von der Mutter wusste? Hätte sie bloß nichts gesagt. Normalerweise sprach sie nicht direkt aus, was sie wirklich dachte. Diesmal hatte sie es getan. Und es war ein Fehler gewesen. Die anderen schauten sie fragend an. Am liebsten hätte sie ihnen die Wahrheit gesagt. Sie wollte nicht mehr lügen. Dann würden die anderen sie jedoch für verrückt erklären. „Ich hatte da so eine Ahnung“, sagte sie. „Du immer mit deinen Ahnungen, das ist ja schon fast gespenstisch“, erwiderten die anderen. Dann wandten sie sich anderen Themen zu. Sie wandte sich ab. Mit einem Ohr hörte sie den anderen zu. Mit dem anderen Ohr lauschte sie der Stimme des Windes.
„Die Welt – was ist das schon?“
Weltbürger Nummer eins ist 45 Jahre alt, Familienvater und stammt aus China. Frühmorgens verlässt er die kleine Wohnung in Schanghai, die er sich mit seiner Frau und seinem Sohn teilt. Auf dem Weg zur Arbeit nimmt er sein neuestes Smartphone zur Hand und informiert sich mithilfe seiner E-Mails über die heutigen Termine.
Währenddessen ist auch Weltbürger Nummer zwei aufgestanden, ein 15-jähriger Engländer. Nach einem kurzen Frühstück macht er sich mit der U-Bahn auf zur Schule, die in einem Vorort von London liegt. Dort lernt er bei Frau Schuster Deutsch.
Frau Schuster, Weltbürgerin Nummer drei, ist Deutsche und lebt mit ihrem Lebensgefährten eigentlich in Duisburg. Da sie in Deutschland keine Arbeit als Lehrerin gefunden hat, unterrichtet sie nun Deutsch als Fremdsprache an einer internationalen Schule in England.
Der Lebensgefährte von Frau Schuster, ein neuseeländischer Klimaforscher und Weltbürger Nummer vier, arbeitet in Duisburg. Zusammen mit seinen deutschen Arbeitskollegen versucht er das Weltklima zu verbessern.
Weltbürger Nummer eins möchte indessen die Wirtschafts Chinas vorantreiben und widmet sich weniger dem Klimaschutz. Nichtsdestotrotz interessiert sich Weltbürger Nummer eins durchaus auch für internationale Themen. Sein Sohn verbringt demnächst ein Austauschjahr in Kanada. Leben wird der Sohn von Weltbürger Nummer eins bei der Familie von Weltbürger Nummer fünf.
Weltbürger Nummer fünf stammt aus Kenia und ist vor Jahrzehnten nach Kanada emigriert. In Kanada nahm er zunächst einen Aushilfsjob an, bekam jedoch bald darauf eine Festanstellung in einer Bäckerei. Nach einigen Jahren lernte er seine spätere Ehefrau kennen. Inzwischen haben die beiden fünf Kinder, zwei Mädchen und drei Jungen.
Der Bruder von Weltbürger Nummer fünf, Weltbürger Nummer sechs, lebt nach wie vor in Kenia. Anders als Weltbürger Nummer fünf lebt Weltbürger Nummer sechs immer noch in einer Hütte aus Wellblech in dem Armenviertel, wo die beiden Brüder aufgewachsen sind. Weltbürger Nummer sechs hat kein Geld, um seine vier Kinder zur Schule zu schicken; sie müssen mit im Steinbruch arbeiten, damit die Familie einigermaßen über die Runden kommt. Die erste Frau von Weltbürger Nummer sechs ist vor einiger Zeit gestorben, inzwischen ist er allerdings wieder verlobt. Weltbürger Nummer sechs ist 60 Jahre, seine Verlobte 15 Jahre alt.
In einem Dorf im Amazonas-Regenwald lebt schließlich Weltbürger Nummer sieben. Ein kleines Indianermädchen, das weder von Smartphones noch vom Klimawandel je etwas gehört hat. Seine Familie hat nicht viel, aber in ihrem Volk gelten sie trotzdem nicht als arm. Alles was sie brauchen, gibt ihnen der Dschungel. Während Weltbürger Nummer sieben auf seine Eltern wartet, die im Dschungel auf Nahrungssuche sind, geht Weltbürger Nummer eins in ein schickes Restaurant und isst dort mit seinen Geschäftspartnern zu Abend.
All dies sind Weltbürger. WIr alle sind Weltbürger, schließlich leben wir alle auf diesem Planeten und teilen somit eine Welt. Es gibt nicht „den Weltbürger“. Menschen sind verschieden und das ist gut so. Den Begriff „Weltbürger“ eindeutig zu definieren fällt dementsprechend schwer. Im weiteren Sinne könnte man sogar Tiere als Weltbürger bezeichnen, da Weltbürger nichts anderes heißt als Erdenbewohner. Nun gut, um sich Bürger nennen zu können, müsste man Mitglied eines Staates sein. Deshalb fallen Tiere wohl doch eher weg. Auch ist ein einziger Staat auf dieser Welt so gut wie unmöglich. Wir sprechen zu viele Sprachen, haben zu unterschiedliche Kulturen und vertreten mitunter gegensätzliche Interessen. Eins haben wir aber dann doch gemeinsam: Wir sind menschliche Wesen und teilen uns diese Welt.
(erschienen in Was ist ein Weltbürger? Schüler und Studierende antworten, ein lesebuch, herausgegeben vom deutschen akademischen Austauschdienst (DAAD), Bonn/Leck, November 2013)
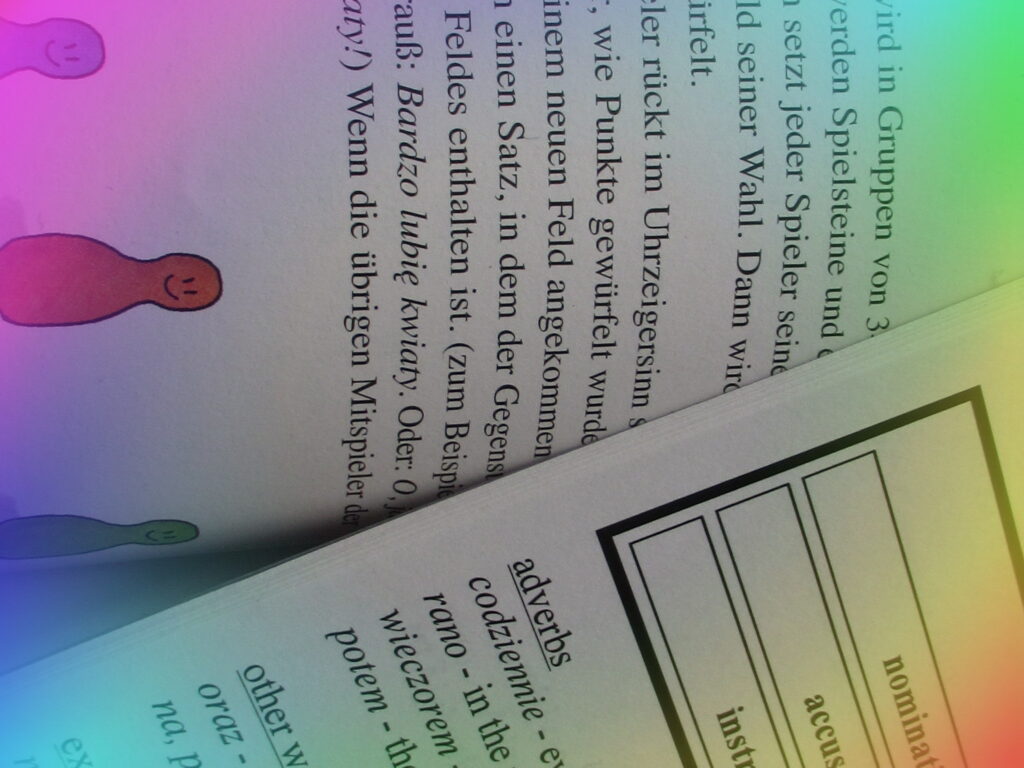
Nichts Besonderes
Vor nicht allzu langer Zeit stieg eine junge Frau, da sie sich in der Übergangsphase vom Kindes- zum Erwachsenenalter befand, träfe die Bezeichnung „Mädchen“ ebenfalls zu, in einem Vorort einer deutschen Großstadt in die S-Bahn. Sie wollte in die Innenstadt. Weil sie noch nicht gefrühstückt hatte, kaufte sie sich am Bahnhof ein belegtes Brötchen.
In der S-Bahn lächelte sie in Mann an. Sie dachte sich nichts dabei und lächelte zurück. Als ihr Blick ihn das nächste Mal streifte, lächelte er erneut, doch nun fiel ihr auf, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Seine Augen lächelten nicht. Ihre Intuition, auf die die junge Frau sich eigentlich immer verlassen konnte, sagte ihr, dass die Situation gefährlich sei. Sie wusste nur noch nicht weshalb. Der Mann lächelte sie abermals an und setzte sich ihr schräg gegenüber. „Wie heißt du?“ Sie antwortete nicht. „Wo wohnst du?“ Sie blieb ihm die Antwort schuldig. Wieder fragte er nach ihrem Namen. „Du hast ein schönes Gesicht.“
In ihrem Kopf klingelten sämtliche Alarmglocken. Ein Fremder, der nur an einem netten Gespräch interessiert war, sagte so etwas nicht. Selbstverständlich konnte sie sich irren, allerdings war sie nicht bereit, ein Risiko einzugehen. Nicht hier und nicht jetzt. In den Augen der übrigen Passagiere las sie Desinteresse. Es schockierte sie. Kurzerhand beschloss sie, an der nächsten Haltestelle auszusteigen und eine andere S-Bahn zu nehmen. Die S-Bahn hielt. Sie stieg aus. Beobachtete den Mann. Die Türen schlossen sich. die S-Bahn fuhr weiter.
Die junge Frau stand alleine am Bahnsteig und zitterte.
Lyrik
Wintersonne
Sie ging im Schnee entlang
und wünschte er wär‘ hier.
Sie seufzte, sah den Schneemann,
„Kinder kommt zu mir!“
Kein Laut war zu hören,
in der weißen Winternacht.
Er sah ihr nach
und wünschte, sie käme zurück.
Er sah zu den Kindern
und dachte „welch ein Glück!“
Es war Sommer.
(erschienen in Begegnung, Zeitschrift für Lyrikfreunde, herausgegeben von der Gesellschaft der Lyrikfreunde, Wien, 32. Jahrgang, Nr. 154, Oktober 2012)
Lebenslauf
Es rennt und rennt.
Dieses Gefühl ein jeder kennt.
Es läuft immer weiter.
Wie ein ungestümer Reiter.
Es besteht aus einem Augenblick.
Der da kehrt nie zurück.
Nichtsdestotrotz lebt es eine Ewigkeit.
Dieses „es“, das ist die Zeit.
Graue Katze
Eine graue Katze, wartend an einer grauen Straßenecke.
Graue Menschen, die in den grauen Läden ein und aus gehen.
Ein graues Mädchen, das die graue Katze sieht.
Die graue Katze bekommt graues Futter, jeden Tag in dieser grauen Stadt inmitten all der grauen Menschen.
Nach einem grauen Jahr, bekommt die graue Katze nichts mehr von dem grauen Mädchen.
Alles wie immer; graue Straßenecke, graue Menschen, und an der grauen Straßenecke:
eine braune Katze.
Wenn du träumst
Wenn du träumst,
dann bist du friedlich.
Wenn du träumst,
dann bist du glücklich.
Wenn du träumst,
dann bist du frei.
Jeder Traum ist mal vorbei.

Lüge
Viele Menschen tun es, auch oftmals ohne jeden Stress.
Sie lügen unbeschwert und heiter, doch die Welt läuft trotzdem weiter.
Die Angst vor der Wahrheit sie dazu treibt; dies ist die bittere Wirklichkeit.
Doch was kosten beide, für dich und für mich?
Die Wahrheit dein Glück.
Die Lüge dein Ich.
Verlorene Kindheit
Federn, flauschig und warm zugleich.
Federn, so wunderbar weich.
Federn, so leicht, dass es zum Fliegen reicht.
Feder, ein ganzer Raum: auf einem hohen, hohen Baum.
Der Raum in sich zusammenbricht.
Alles lärmt und kreischt und zischt.
Der Raum, die Federn; völlig zerstört.
Der Ruf nach Hilfe; nicht erhört.
Mit diesem Fall fängt das Leben an,
das sich da hängt an die verlorene Kindheit dran.
„Play“
Sie dachte, sie wär‘ glücklich.
Sie dachte, sie blieb‘ hier.
Sie hört den Ruf der Ferne,
„Mädchen, komm zu mir!“
Da ist das Feuer wieder da,
die Leidenschaft, die längst versiegt.
Sie packt den Koffer und geht los,
Und trotzdem, ja, sie blieb.
Blumenmädchen
Die Blumen,
ja sie sprechen,
jeden Tag zu mir,
jeweils eine Stunde,
jede nur zu mir.
Der Wind begrüßt mich freudig,
er weiß, die Stund‘ ist da.
Er hört uns gerne reden,
er ist immer da.
Das Wasser flüstert leise,
erzählt mir von der großen Welt.
Ich möchte hier nicht weg,
nicht für alles Geld der Welt.
Sie sehen sie und wundern sich;
die, die mit den Blumen spricht.
Sie zucken mit den Schultern
und gehen eilig weiter.
Er sieht sie.
Er bekommt Angst.
Er kann sie nicht verstehen.
Er kann sie nicht kontrollieren.
Er wählt eine Nummer.
